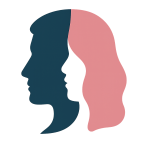Ich will nicht auffallen – aber sichtbar sein
Es ist schwer zu erklären, dieses Gefühl, das mich begleitet, wenn ich als Tamara unterwegs bin. Es ist keine Angst, nicht mehr. Und auch kein Stolz, obwohl ich vieles erreicht habe, was mir früher unmöglich erschien. Es ist etwas anderes – ein stilles Sehnen nach Echtheit. Nach Anerkennung, ohne Aufsehen. Nach einem Platz in der Welt, der mir gehört, ohne dass ich ihn mir laut erkämpfen muss.
Denn ich will nicht auffallen. Aber ich möchte gesehen werden.
Es klingt wie ein Widerspruch. Ist es vielleicht auch. Und doch beschreibt dieser Satz ziemlich genau das Spannungsfeld, in dem ich mich als Teilzeit-Frau bewege. Als Crossdresserin, die nicht unbedingt provozieren möchte. Aber die auch nicht mehr unsichtbar sein will. Ich brauche keine große Bühne. Kein Blitzlicht, kein Drama. Ich brauche etwas anderes: einen echten Moment, in dem ich einfach ich sein darf – als Frau, als Tamara, ohne Erklärung, ohne Ausrufezeichen.
Früher war das anders. Da war mein größtes Ziel, im Alltag nicht aufzufallen – im wortwörtlichen Sinne. Nicht im Sinne von Tarnung – sondern im Sinne von Rückzug. Kleider, Perücke, Make-up? Ja, aber bitte nur zu Hause. Die Tür zu. Die Jalousien halb runter. Und wenn es klingelt: tief durchatmen und warten, bis es wieder still ist.
Ich wollte im ganz normalen Alltag nicht auffallen, nicht gesehen werden.
Weil ich Angst hatte. Weil ich nicht wusste, was passiert, wenn jemand hinschaut. Und vielleicht auch, weil ich selbst noch nicht genau wusste, wer da eigentlich angeschaut wird.
Zwischen Karneval und Kaffeepause – meine neue Sichtbarkeit
Früher war Tamara meine Karnevalsidentität. Sie tauchte dann ein oder zweimal im Jahr auf – für ein paar Stunden am Abend, manchmal für einen ganzen Tag. Und danach war sie wieder weg. Ich liebte diese erlaubte und akzeptierte Verwandlung, das Spiel mit Make-up, Kleid und Haltung. Und ja, an diesen Tagen habe ich es auch genossen, aufzufallen. Auf den Faschingsbällen, auf Kostümpartys, im Scheinwerferlicht eines Events. Es war das große Gesehenwerden – ein kurzer Auftritt auf einer Bühne, die genau dafür gemacht war.
Aber sobald die Musik verklang, wurde das Kleid wieder eingepackt. Die Perücke abgenommen. Die Bühne leer.
Und mit ihr verschwand auch Tamara – bis zum nächsten Jahr.
Damals war dieses Sichtbarsein und das Auffallen etwas Anderes. Es war erlaubt, erwartet, begrenzt. Man konnte sich zeigen, ohne sich wirklich zu zeigen. Denn wer sich zu Fasching in ein feminines Outfit wirft, der spielt nur – so dachten viele. Auch ich habe mich lange Zeit hinter dieser Idee versteckt. Es war eine Art Schutzmantel.
Ein „Ich darf das jetzt – aber es ist ja nur Spaß“.
Heute suche ich eine andere Art von Sichtbarkeit.
Eine, die nicht vom Event lebt. Sondern vom Moment.
Ich möchte nicht länger Teil einer Verkleidung sein, die nur für besondere Anlässe funktioniert – ich wünsche mir, als die gesehen zu werden, die ich wirklich bin. Beim Frühstück im Hotel, beim Bummeln durch die Stadt, beim Cappuccino in der Sonne. Ganz ohne Anlass. Ganz ohne Bühne.
Und genau hier liegt der Unterschied:
Früher wollte ich ein paar wenige Stunden oder Tage im Jahr Aufmerksamkeit – heute will ich Anerkennung.
Früher war Tamara ein Auftritt – heute ist sie Teil meines Alltags.
Nicht, weil ich plötzlich mehr Aufmerksamkeit suche. Nicht, weil ich gefallen will. Sondern weil ich mir selbst genügen will. Weil ich wissen will, wie es ist, Tamara nicht nur im Spiegel, sondern im echten Leben zu sein.
Nicht enttarnt. Nicht analysiert. Sondern einfach erkannt in dem, was ich da bin und wie ich mich in dem Moment präsentiere: eine Frau, die sich zeigt, wie sie sich fühlt. Eine Frau, die da ist.
Und ja, ich sage das bewusst so – obwohl es klar ist, dass ich keine biologische Frau bin. Aber Tamara ist nicht weniger echt, nur weil sie nicht durchgängig präsent ist. Sie ist ein Teil von mir – und wenn ich sie zeige, dann mit allem, was dazugehört: Haltung, Stil, Verletzlichkeit.
Und danach? Danach kann ich genauso gut wieder in meine männliche Rolle zurückkehren, mit Freunden ein paar Bier trinken, über Technik reden, Familienmensch sein. Beides gehört zu mir. Es ist kein Widerspruch – es ist einfach mein Leben.
Von Blicken, Begegnungen – und der kleinen Kunst des „Dazwischen“
Es gibt Tage, da gehe ich durch die Stadt, geschminkt, gestylt, ganz Tamara – und niemand schaut. Oder wenn jemand schaut, dann freundlich, interessiert, manchmal sogar bewundernd. Und genau das sind die Momente, die sich richtig anfühlen. Nicht, weil ich Aufmerksamkeit suche. Sondern weil ich spüre, dass ich mich nicht verstecken muss.
Ich erinnere mich an einen dieser Nachmittage im letzten Urlaub, irgendwo zwischen Cappuccino und Bummeln. Eine ältere Frau kommt mir entgegen, sieht mich an, lächelt und nickt leicht. Kein großes Zeichen, keine Worte. Aber da war etwas in diesem Blick – Respekt vielleicht. Oder einfach die leise Anerkennung dafür, dass ich mich traue, da zu sein.
Solche Begegnungen sind selten spektakulär, aber sie bestätigen mir: Ich darf existieren. So, wie ich bin. Und ich muss dafür nicht laut sein, nicht schrill, nicht polarisierend. Ich darf einfach meinen Platz einnehmen – zwischen all den anderen.
Und ja, ich weiß, dass ich damit nicht jedem gefalle. Dass es immer Menschen geben wird, die mich „lesen“, die merken, dass ich keine Cis-Frau bin. Aber das ist okay. Es geht mir nicht darum, etwas zu verstecken – sondern darum, mir selbst treu zu bleiben. Ich will mich nicht erklären müssen – aber ich möchte auch nicht verstellt erscheinen.
Sichtbarkeit ist kein Spektakel. Sie ist ein Recht.
Oft wird Sichtbarkeit mit Lautstärke verwechselt. Mit Kampf, mit Demonstration, mit dem Wunsch, die Welt zu verändern. All das ist wichtig und für viele ist es auch genau der richtige Weg. Ich bewundere jeden, der laut und mutig vorangeht.
Aber mein Weg ist ein anderer.
Ich glaube an die Kraft der Normalität. An die Macht der leisen Präsenz. Ich glaube, dass es etwas verändert, wenn ich als Tamara durch die Straßen gehe, mir ein Eis kaufe, im Café sitze oder eine Boutique durchstöbere. Nicht, weil ich auffalle – sondern weil ich da bin.
Ich möchte zeigen, dass es diese Möglichkeit gibt: seine Femininität auszuleben, auch wenn der Alltag ein anderer ist. Frau zu sein – in bewusst gewählten Momenten – und sich dabei nicht als Fremdkörper zu fühlen, sondern als Mensch.
Was ich mir wünsche, ist keine Bühne. Es ist ein Lächeln, ein „Guten Tag“ ohne Stirnrunzeln, eine Beratung im Laden, die nicht stockt, wenn ich spreche. Es sind diese alltäglichen Dinge, die für viele selbstverständlich sind – und für uns manchmal so viel Mut kosten.
Vielleicht ist genau das mein Beitrag
Nicht jeder muss laut sein, um etwas zu bewegen.
Und nicht jede Sichtbarkeit braucht eine Erklärung.
Ich habe für mich gelernt: Es reicht manchmal, einfach da zu sein. Nicht, um bewundert zu werden. Sondern um mich selbst zu spüren – und anderen zu zeigen, dass es möglich ist. Dass man sich zeigen darf. Auch ohne perfekt zu sein. Auch mit Ecken, Kanten und kleinen Unsicherheiten.
Denn am Ende geht es nicht um makelloses Passing.
Es geht um das Gefühl, dass ich dazugehören darf.
Ganz ohne Verkleidung. Ganz ohne Show.
Einfach, weil ich da bin. Und weil das reicht.
Mit Liebe,
Tamara 💕
📸 Lust auf mehr?
Wenn du neugierig bist, wie das aussieht – dieses „nicht auffallen, aber gesehen werden“ –
dann begleite mich doch auch auf Instagram. Dort zeige ich meine Outfits, kleine Momente aus dem Alltag und ein paar Gedanken zwischendurch.
Ich freue mich, wenn du vorbeischaust – und vielleicht sogar bleibst. 💕
👉 @tamaralisell